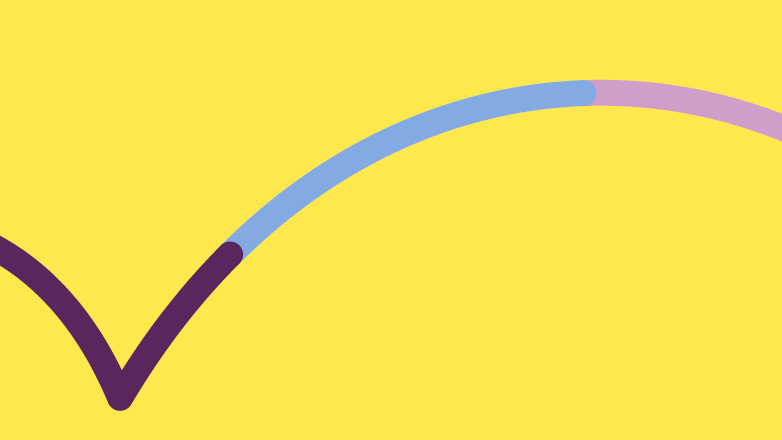Gespräche auf EU-Ebene zur Legalisierung von Genusscannabis – das Eckpunktepapier der Bundesregierung wird nicht ausreichen
Die Bundesregierung legt der EU-Kommission ihre Eckpunkte für eine Legalisierung von Genusscannabis zu einer informellen Prüfung vor. Nur wenn die Kommission das liberale Verständnis der EU- und völkerrechtlichen Vorgaben für Cannabis teilt, soll es einen Gesetzesentwurf geben. Dem Papier fehlt es allerdings noch an handfesten Argumenten. Hier besteht Nachbesserungsbedarf. Zugleich setzt der Bundesgesundheitsminister alles auf eine Karte: Volllegalisierung ohne Plan B. Dabei wären die wesentlichen Ziele des Gesetzgebungsvorhabens vorläufig auch innerhalb des arznei- und betäubungsmittelrechtlichen Rahmens umsetzbar. Wenn Plan A auf Widerstand stößt, sollte die Regierung der EU-Kommission diese Alternative vorstellen, anstatt das Projekt zu beerdigen.
Am 26. Oktober hat die Bundesregierung ihr Eckpunktepapier „zur Einführung einer kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken“ vorgestellt. Darin werden die Ergebnisse der umfangreichen Konsultationen und Expertengespräche im Sommer präsentiert. Die Regierung plant, den Erwerb und Besitz von 20–30 Gramm Cannabis sowie den privaten Anbau von bis zu drei weiblichen Pflanzen zu erlauben. Gewerbliche Produktion und Vertrieb der Produkte sollen in Deutschland ebenfalls legal sein, aber einer strikten staatlichen Kontrolle unterliegen. Der Verkauf an Konsumenten ist in staatlich lizenzierten Fachgeschäften – ggf. ergänzend in Apotheken – vorgesehen. Es sollen ein striktes Werbeverbot und strenge Kennzeichnungsvorgaben gelten. Eine THC-Obergrenze soll allenfalls für junge Nutzer unter 21 Jahren geben.
Legalisierung ist mit EU- und Völkerrecht vereinbar
Das Papier erläutert vorab die EU- und völkerrechtlichen Vorgaben für den Umgang mit Cannabis. Die Bundesregierung stellt klar, dass eine Legalisierung innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens grundsätzlich möglich ist. Damit positioniert sie sich gegen einige Kritiker, die der Cannabislegalisierung bereits vorschnell ein Schicksal wie der Pkw-Maut prophezeiten . Keine der einschlägigen Regelungen enthält ein klares Verbot der Einführung eines staatlich kontrollierten Marktes für Cannabisprodukte zu Genusszwecken. Wie eng der rechtliche Rahmen für das geplante Gesetzesvorhaben ist, hängt von der Auslegung dieser Vorschriften ab.
Klarstellung durch Interpretationserklärung
Die Bundesregierung plant, ihr Verständnis der einschlägigen Regelungen in einer sogenannten „Interpretationserklärung“ gegenüber den anderen Vertragsparteien der internationalen Übereinkommen und den internationalen Drogenkontrollgremien klarzustellen. Darin soll festgehalten werden, dass das geplante staatliche Kontrollsystem für Genusscannabis den Gesundheits- und Jugendschutz stärkt und dem primären Ziel der Abkommen – der Bekämpfung des illegalen Drogenhandels – besser dient als die bislang vorherrschende Politik der Prohibition.
Pionierarbeit in enger Abstimmung mit der EU-Kommission
Bevor das Kabinett mit dem finalen Gesetzesentwurf befasst werden kann, muss dieser ein förmliches Notifizierungsverfahren bei der EU-Kommission durchlaufen. Dies sieht das EU-Recht für solche Gesetze standardmäßig vor, um der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Die Liberalisierung von Cannabis ist jedoch kein gewöhnliches Vorhaben. Deutschland will Pionierarbeit leisten und ein Modell entwickeln, das Vorbild für andere Staaten der EU und weltweit sein kann.
Daher will sich die Bundesregierung schon im Vorfeld eng mit der EU-Kommission abstimmen. Bei der Vorstellung des Eckpunktepapiers am 26. Oktober kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach an, dass die Eckpunkte zu diesem Zweck zeitnah der EU-Kommission vorgelegt werden sollen.
„Europarechtlich wird es auf eine enge und transparente Abstimmung ankommen, damit EU-Kommission und Mitgliedsstaaten dem Interpretationsansatz Deutschlands folgen und um das Risiko von Vertragsverletzungsverfahren und/ oder Staatshaftungsansprüchen zu minimieren, über die letztlich der EuGH zu entscheiden hätte“, heißt es dazu im Eckpunktepapier.
Nachbesserungsdarf bei der Argumentation
Wie die Bundesregierung gegenüber der EU-Kommission im Einzelnen argumentieren will, lässt das Eckpunktepapier allerdings offen. Es deutet lediglich an, dass die Aspekte der staatlichen Kontrolle, des Gesundheitsschutzes und der internationalen Kriminalitätsbekämpfung für eine Vereinbarkeit mit dem Zweck der völkerrechtlichen Vorgaben angeführt werden können. Dies wird nicht genügen, um die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten von der Zulässigkeit des Projekts zu überzeugen.
Denn das bestehende Regulierungsgefüge ist komplex. Die beiden entscheidenden Regelungen des EU-Rechts – Art. 71 des Schengener Durchführungsübereinkommens (SDÜ) sowie der Rahmenbeschluss 2004/757/JI des Rates – verweisen an wesentlichen Stellen auf die älteren völkerrechtlichen Verträge. Bei der Interpretation ist neben dem Wortlaut einzelner Normen vor allem die Gesamtsystematik und der Zweck der Regulierung zu beachten. Die Bundesregierung muss erläutern, inwiefern diese Bestimmungen Raum lassen für eine an den im Eckpunktepapier genannten Aspekten ausgerichtete Legalisierung. Hier besteht Nachbesserungsbedarf.
Vorschriften lassen konzeptionellen Raum für nationale Regulierungsansätze zur Bekämpfung des illegalen Drogenmarkts
Primärer Zweck der Völkerrechtsabkommen und der EU-Bestimmungen ist es, den – naturgemäß grenzüberschreitenden – illegalen Drogenhandel gemeinsam zu bekämpfen, um die Gesundheit und Sicherheit der Bürger zu schützen (siehe etwa Erwägungsgründe 1–3 Beschluss 2004/757/JI). Dazu ist es nicht erforderlich, Cannabis generell aus allen beteiligten Ländern zu verbannen.
Dementsprechend sehen die Regelungen verschiedene Ausnahmen vor. Eine Verwendung zu medizinischen und wissenschaftlichen Zwecken ist nach den internationalen Abkommen ausdrücklich erlaubt. Das Schengener Durchführungsübereinkommen ergänzt dies in der Gemeinsamen Erklärung der Vertragsparteien zu Art. 71 Abs. 2. Danach sind Abweichungen von den Cannabis-Verboten auf nationaler Ebene „zur Vorbeugung und Behandlung der Abhängigkeit von Suchtstoffen“ möglich. Der EU-Rahmenbeschluss überlässt es zudem den einzelnen Mitgliedstaaten, ob sie Handlungen zum Zwecke des persönlichen Konsums von Cannabis erlauben.
Der Wortlaut der europarechtlichen Verbotsnormen spiegelt dieses Regel-Ausnahme-Prinzip. Art. 71 Abs. 1 SDÜ ist auf „die Unterbindung des unerlaubten Handels“ beschränkt. Art. 2 Abs. 1 Beschluss 2004/757/JI betrifft nur Handlungen, „wenn sie ohne entsprechende Berechtigung vorgenommen wurden“. Welche nationalen „Erlaubnisse“ und „Berechtigungen“ für bestimmte Stoffe und Produkte möglich sind, sagen die Vorschriften nicht. Dies muss durch eine Interpretation nach Sinn und Zweck der Gesamtregulierung ermittelt werden.
Rechtliche Begründungsansätze für die Interpretationserklärung der Bundesregierung
Hier kann die Interpretationserklärung der Bundesregierung anknüpfen. Die Einführung eines streng überwachten Marktes als staatliche Drogenkontrollmaßnahme schafft die erforderliche „Berechtigung“ für den Handel in Deutschland. Die regulierte Abgabe an Erwachsene wird den Zielen der Verträge und Regelungen sogar besser gerecht als die bislang vorherrschende Politik der Prohibition.
Im Eckpunktepapier bezeichnet die Bundesregierung ihr Vorhaben auch als „Reaktion auf eine geänderte Risikobewertung“. In der Tat hat sich der wissenschaftliche Kenntnisstand verändert, auf dessen Basis die internationalen Verträge und europarechtlichen Vorgaben bislang als striktes Cannabisverbot ausgelegt wurden: Zum einen zeigen die Erfahrungen mit Cannabis als Medizin, dass das frühere Dogma des rein schädlichen Stimulans überholt ist. Die Zulassung von Cannabisblüten und -extrakten als Medikamente im Jahr 2017 war der folgerichtige Paradigmenwechsel im deutschen Recht. Zum anderen belegen die steigenden Nutzungszahlen bei Jugendlichen und die zunehmenden Fälle verunreinigter Cannabisprodukte, dass die Prohibition als Maßnahme des Gesundheitsschutzes gescheitert ist. Aus rechtlicher Sicht handelt es sich um eine sogenannte „Änderung der Normsituation“. Die neuen Erkenntnisse sind bei der Auslegung der europäischen und völkerrechtlichen Normen – einschließlich der darin normierten Ausnahmen – zu berücksichtigen.
Zusätzlich kann sich die Bundesregierung darauf berufen, dass die geplante Regulierung des gewerblichen Anbaus und Handels zur konsistenten Umsetzung des EU-Rahmenbeschlusses geboten ist. Deutschland will von der in Art. 2 Abs. 2 vorgesehenen Option Gebrauch machen, den Umgang mit Cannabis zu Zwecken des persönlichen Konsums zu erlauben. Dies ist aber mit dem Ziel der Bekämpfung des illegalen Drogenmarktes nur vereinbar, wenn dieser zugleich durch einen streng kontrollierten, legalen Markt ersetzt wird. Denn der EU-Gesetzgeber wollte mit der Ausnahmevorschrift kein nationales Gesetz ermöglichen, das den Schwarzmarkt befördert, statt ihn zu bekämpfen.
Mit ihren Vorkehrungen zum Jugendschutz und der streng kontrollierten Abgabe an Erwachsene dient die geplante Legalisierung schließlich der „Vorbeugung und Behandlung der Abhängigkeit von Suchtstoffen“ im Sinne der Gemeinsamen Erklärung der Vertragsparteien zu Art. 71 Abs. 2 SDÜ.
Volle Legalisierung – volles Risiko – kein Plan B?
Die Bundesregierung will Cannabisprodukte zu Genusszwecken und zu medizinischen Zwecken sowie Nutzhanf vollständig aus dem Anwendungsbereich des Betäubungsmittelgesetzes ausnehmen. Denn, so erläutert sie im Eckpunktepapier, die „Option einer nur eingeschränkten Legalisierung mit dem Fokus auf Eigenanbau zum persönlichen Konsum und Eigenbesitz würde hinter dem Auftrag des Koalitionsvertrages zurückbleiben“.
Zugleich kündigte Karl Lauterbach bei der Pressekonferenz am 26. Oktober an, dass sich das weitere Vorgehen der Regierung nach dem Feedback der EU-Kommission richten werde: Sofern die EU-Kommission grünes Licht gebe, könne die Regierung sehr schnell einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegen. In diesem Fall sei auch ein Vertragsverletzungsverfahren unwahrscheinlich. Wenn die EU-Kommission das Vorhaben jedoch ablehne, werde es kein Gesetz auf der Grundlage des Eckpunktepapiers geben. Sollte die EU-Kommission lediglich an einzelnen Aspekten der Eckpunkte Kritik üben, wolle die Bundesregierung den Gesetzesentwurf entsprechend anpassen.
Inhaltlich fährt die Regierung also einen harten Kurs. Die Verantwortung für das Gelingen oder Scheitern des Vorhabens gibt sie allerdings an die EU-Kommission ab. Eine frühzeitige Abstimmung mit der EU-Kommission ist natürlich sinnvoll. Statt jedoch alles auf eine Karte zu setzen, sollte die Bundesregierung für den anstehenden Dialog noch eine Alternative in der Hinterhand haben.
„Legalisierung light“ kann der EU-Kommission als Alternative vorgestellt werden
Die vollständige Legalisierung von Genusscannabis in einem EU-Staat wäre ein beachtlicher Schritt in der internationalen Drogenpolitik. Sollte dieser Plan derzeit noch auf erheblichen Widerstand stoßen, muss die Bundesregierung nicht das gesamte Vorhaben aufgeben. Vielmehr kann sie vorläufig eine „Legalisierung light“ umsetzen, die sich enger an den EU- und völkerrechtlich normierten Ausnahmen für medizinische und wissenschaftliche Zwecke ausrichtet.
Dazu kann der Gesetzgeber testweise eine neue Kategorie von medizinischen Cannabisprodukten in das Arzneimittelgesetz einführen, die ohne ärztliche Verschreibung – ggf. auch außerhalb von Apotheken – abgegeben werden dürfen. Erwachsene Verbraucher könnten diese Produkte frei erwerben und in eigener Verantwortung nutzen, ähnlich wie etwa Aspirin oder Arzneitees. Damit würde der Schwarzmarkt für vergleichbare Produkte obsolet. Es handelte sich um eine politische Maßnahme zur „Vorbeugung […] der Abhängigkeit von Suchtstoffen“, wie sie die Gemeinsame Erklärung der Vertragsstaaten zu Art. 71 Abs. 2 SDÜ ausdrücklich zulässt. Zugleich könnte die Bundesregierung mittels paralleler Begleitforschung Daten zu Nutzungsgewohnheiten, Suchtgefahr und Wirkung für die Suchtprävention erheben. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse könnten wiederum genutzt werden, um weitere Überzeugungsarbeit auf internationaler Ebene zu leisten und mittelfristig eine vollständige Legalisierung zu erreichen.
Internationaler Handel von Genusscannabis zu Unrecht ausgeschlossen
Die Bundesregierung vertritt in ihrem Eckpunktepapier die „vorläufige“ Auffassung, dass „ein internationaler Handel von Cannabis zu Genusszwecken auf Basis bzw. im Einklang mit bestehenden internationalen Rahmenbedingungen nicht möglich“ sei. Der Bedarf soll daher vollständig durch die Produktion in Deutschland gedeckt werden.
Dies ist aus rechtlicher Perspektive nicht nachvollziehbar. Zwar dürfte in Deutschland legal produziertes Genusscannabis nicht in Länder exportiert werden, in denen solche Produkte verboten sind. Ein Handel zwischen Deutschland und einem anderen Staat ist aber grundsätzlich möglich, soweit beide Länder – im Einklang mit den europa- und völkerrechtlichen Bestimmungen – das Inverkehrbringen von Cannabisprodukten erlauben. Die am grenzüberschreitenden Handel beteiligten Länder müssen dann nach der Gemeinsamen Erklärung der Vertragsparteien zu Art. 71 Abs. 2 SDÜ die erforderlichen Maßnahmen treffen, um die unerlaubte Ein- und Ausfuhr in das Hoheitsgebiet anderer Vertragsparteien zu unterbinden, in denen dieser Handel verboten ist.
Innerhalb der EU sind grenzüberschreitende gewerbliche Tätigkeiten von der Dienstleistungs- und/oder Warenverkehrsfreiheit geschützt, wenn sie in den beteiligten Ländern erlaubt sind. Deutschland dürfte daher die Einfuhr von legal produziertem Cannabis aus EU-Ländern allenfalls beschränken, wenn dies ausnahmsweise durch Gründe des Gesundheitsschutzes gerechtfertigt wäre. Soweit das Einfuhrland gleichwertige Sicherheits- und Qualitätsstandards wie Deutschland gewährleistet, kommen jedenfalls pauschale Einfuhrverbote nicht in Betracht.
Dies gilt erst recht, wenn die Bundesregierung vorläufig nur eine Zugangserleichterung für Cannabis zu medizinischen und wissenschaftlichen Zwecken innerhalb des Arzneimittelgesetzes schaffen würde („Legalisierung light“). In diesem Fall wäre der grenzüberschreitende Handel dieser Produkte – wie bei medizinischem Cannabis bereits heute – unmittelbar von den im EU- und Völkerrecht normierten Ausnahmen erfasst.